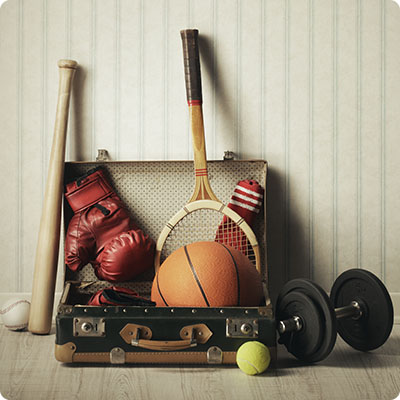Die Perle: ein antiker Mythos
Die ersten archäologischen Spuren des Perlenfischens in der Region reichen fast 4000 Jahre zurück. ImGilgamesch-Epos könnte das Geheimnis der Unsterblichkeit, das der Held auf den geheimnisvollen Inseln sucht, nach Ansicht von Historikern diese berühmten Perlen sein. Bereits zur Zeit Dilmuns wurde auf mesopotamischen Tafeln von den "glänzenden Steinen" aus dem Süden berichtet. Bahrain profitierte von seinem Meeresboden und der Auster Pinctada radiata, die dafür bekannt ist, außergewöhnlich feine Perlen zu produzieren. Diese Naturjuwelen sind das Ergebnis eines Selbstverteidigungsprozesses der Austern: Wenn Parasiten die Muschel angreifen, schützt sie sich, indem sie einen Perlmuttball bildet. Diese Sekrete formen diese Perlen, die zu den schönsten der Welt gehören: Sie verführen schon früh die großen Zivilisationen der Mittelmeerwelt - Griechen, Römer und später auch die Venezianer, Moguln oder Osmanen, die sich um diese seltenen Perlen reißen.
Jahrhundert erwähnte Marco Polo in seinen Berichten die Perlen des Golfs. Jahrhunderte später schmückten sie den Schmuck der Eliten in Istanbul und Delhi und später auch an den europäischen Höfen. Jahrhunderts machte das Haus Cartier sie zu einem seiner Lieblingsmaterialien: Jacques Cartier hielt auf seiner Reise durch den Golf in Bahrain an und suchte die schönsten Stücke selbst aus, die er für die Halsketten des englischen Adels und die Diademe der französischen Haute Bourgeoisie bestimmte. Die unregelmäßigen, aber strahlenden Perlen aus Bahrain eroberten daraufhin die Spitze des weltweiten Luxus.
Eine vom Meer strukturierte Wirtschaft und Gesellschaft
Ab dem 18. Jahrhundert wurde die Perlenfischerei zur Haupteinnahmequelle des Archipels. Jedes Jahr beginnt die Hauptsaison(ghaus al-kabir) im Mai und mobilisiert Tausende von Männern. Die Schiffe werden von nakhudas - erfahrenen Kapitänen - geleitet, die Taucher(ghawwās), Ruderer(saib) und Helfer anwerben. Die Expeditionen, die mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, werden ohne Zwischenstopps durchgeführt. An Bord schlafen die Menschen unter freiem Himmel und sind der drückenden Hitze, dem Hunger, den Golfstürmen oder den Haien ausgesetzt.
Die Taucher lassen sich mithilfe von Steinen, die als Gewichte dienen, auf den Meeresgrund hinab und tauchen dann jeden Tag Dutzende Male bis zu zehn Meter tief. Ausgestattet mit Seilkörben und ledernen Nasenklammern durchkämmen sie den Meeresboden, in der Hoffnung, die Auster zu entdecken, die eine außergewöhnliche Perle verbirgt. Die meisten Muscheln sind leer oder enthalten deformierte Perlen. Nur eine winzige Minderheit enthält eine Dana: eine perfekt runde, perlmuttartige Perle, die von unschätzbarem Wert ist.
Eine Gesellschaft, die auf das Meer ausgerichtet ist
Die Perlengesellschaft folgt einer strengen, fast feudalen Struktur. Jedes Besatzungsmitglied, vom Kapitän bis zum jüngsten Assistenten, hat eine bestimmte Rolle und einen festgelegten Anteil an der Beute. Die Nakhudas, die gleichzeitig Kapitäne und Investoren sind, sind oft lokale Honoratioren, die als einzige die Geheimnisse des Meeres kennen und sich auf ein Netz von Handelsbeziehungen stützen. Sie rekrutieren ihre Mannschaft auf Kredit, im Vorgriff auf die erhofften Gewinne. Dieses System schafft eine starke wirtschaftliche Abhängigkeit, insbesondere für die ghawwās, die Taucher, deren Tapferkeit zwar hervorgehoben wird, die aber meist in bitterer Armut leben.
Die ghawwās sind junge, kräftige Männer, die oft aus bescheidenen Familien in Muharraq oder Sitra stammen. Ihr Alltag ist von extremer körperlicher Anstrengung geprägt: Sie arbeiten zwischen zehn und zwölf Stunden am Tag. Schnorcheln ist ein gefährlicher Beruf: Synkope, Ertrinken, innere Verletzungen durch den Druck... Bei jedem Tauchgang riskieren sie ihr Leben. Doch sobald sie wieder an Land sind, werden sie als wahre Helden gefeiert. Ihr Totenlied(fidjeri) gilt als eines der wichtigsten Vermächtnisse der maritimen Kultur des Golfs. Man sagt sogar, dass ein guter Taucher so viele Lieder wie Tauchtechniken kennen muss. Diese Melodien, die mündlich von Generation zu Generation weitergegeben werden, sind sowohl Gebete, um die Rückkehr an Land zu sichern, als auch legendäre Erzählungen, die das Meer als Geliebte, Feindin oder Mutter und Ernährerin beschwören.
Die Ruderer hingegen werden im Allgemeinen weniger hoch angesehen, sind aber für die Navigation und die Logistik an Bord unerlässlich. Der Siyub, derjenige, der dem Taucher hilft, an die Oberfläche zu kommen, indem er das Seil zieht, spielt eine lebenswichtige Rolle für das Überleben des Ghawwās. Diese Solidarität wird oft zu einem unverbrüchlichen Band zwischen den Besatzungsmitgliedern. Beziehungen, die sich auch an Land fortsetzen: Familien, die vom Perlenfischen leben, schließen sich oft durch Heirat zusammen.
Jeden Sommer, wenn die Saison beginnt, ist die Stadt Muharraq in Aufruhr: Handwerker reparieren die Rümpfe der Dhows, Mütter flechten Seile und Imame lesen Verse aus dem Koran, um die Expeditionen zu segnen. Die Männer brechen mit einer Handvoll Datteln, getrocknetem Fisch und einem Krug mit Süßwasser auf. Ihnen werden Amulette anvertraut, die sie vor dem Ertrinken schützen sollen. Bei ihrer Rückkehr am Ende des Sommers versammelt sich die ganze Gemeinde an den Docks, um diejenigen zu begrüßen, die das Glück hatten, zu überleben - und um die Vermissten zu trauern.
Höhepunkt und dann der Niedergang
Die Perlenindustrie in Bahrain erreichte ihren Höhepunkt Ende des 19. und Anfang des 20. Schätzungsweise ein Drittel der Bevölkerung hing damals direkt oder indirekt von dieser Tätigkeit ab: In den 1930er Jahren lebten mehr als 30.000 Menschen von der Industrie. Die bahrainischen Perlen, die bis nach Paris oder Tokio verkauft wurden, wurden zum Inbegriff von Luxus und Eleganz. Albert London widmete bei seinem Besuch am Golf in den 1930er Jahren einige begeisterte Zeilen diesen Männern, "die auf den Grund des Wassers tauchen, um die Stille zu suchen und das Licht zu berichten".
Dieser Wohlstand wurde jedoch durch zwei große Ereignisse jäh unterbrochen. Zum einen machte die Entwicklung von Zuchtperlen durch Kokichi Mikimoto in Japan das Naturperlmutt weniger wettbewerbsfähig. Diese industriell gefertigten Perlen, die in Massen produziert wurden, einheitlich und viel billiger waren, überschwemmten den Weltmarkt. Andererseits lenkt die Entdeckung von Erdöl in Bahrain im Jahr 1932 die Wirtschaft vom Meer auf das Land. Das Perlenmodell bricht zusammen: Die Dhows werden aufgegeben, die Werften verlassen, das Know-how vergessen.
Ein bewahrtes Erbe
Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Seit den 2000er Jahren setzen sich die bahrainischen Behörden für die Wiederherstellung dieses grundlegenden Erbes ihrer Identität ein. Der "Perlenpfad" in Muharraq, der 2012 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde, verbindet auf einer Länge von 3,5 Kilometern 17 historische Gebäude, drei Küstenorte und einen alten Hafen. Er ermöglicht es, den Alltag der Perlenfamilien nachzuempfinden, die soziale Organisation zu verstehen und die Orte zu sehen, an denen die Expeditionen vorbereitet wurden.
Das Nationalmuseum von Bahrain stellt eine einzigartige Sammlung von Objekten aus, die mit dieser Zeit in Verbindung stehen: Tauchwerkzeuge, alter Schmuck und Navigationsinstrumente. Einige Perlen stammen aus dem 1. Jahrhundert n. Chr., andere wurden direkt von europäischen Juwelieren bei lokalen Händlern in Auftrag gegeben. Man findet sogar Auszüge aus Logbüchern, die von französischen Händlern mit Anmerkungen versehen wurden.
Das jährlich stattfindende Meeresfestival bietet Wassersportwettbewerbe, traditionelle Tauchvorführungen und Fidschi-Gesänge. Einige junge Bahrainis lernen noch auf die altmodische Art zu schnorcheln.
Die Perle, das Symbol Bahrains
Heute ist Bahrain das einzige Land der Welt, in dem die Naturperlenfischerei noch legal, mit Lizenz und strengen Quoten betrieben wird. Einige wenige Schmuckhandwerker arbeiten weiterhin ausschließlich mit diesen Naturperlen, die als letzte noch aus dem Meer geerntet werden. Als Hochzeitsgeschenk, das von Mutter zu Tochter weitergegeben wird, bleibt die Perle mit Emotionen und Erinnerungen verbunden.
Aber mehr noch, sie wird zu einem Schlüssel für die Interpretation der zeitgenössischen bahrainischen Identität. In einem Land, das sich im Umbruch befindet und von der Globalisierung und den radikalen Veränderungen, die die Welt erschüttern, erfasst wird, ist die Erinnerung an diese Männer, die ihr Leben auf dem Meeresgrund riskierten, zu einem Identitätsmarker geworden. Die Regierung lässt über die Behörde für Kultur und Antiquitäten diese Vergangenheit wieder aufleben und macht sie zu einem Teil des bahrainischen Nationalromans.
In den Schulen wird in den Geschichtsbüchern nun über das Leben der Fischer in der Vergangenheit berichtet. Die Kinder besuchen die restaurierten Häuser der Nakhudas, hören Fidschi-Aufnahmen und lernen, traditionelle Werkzeuge zu identifizieren. Eine Erinnerungspflicht, die unter anderem von der UNESCO und der Regierung unterstützt und finanziert wurde und die diese jahrtausendealte Kultur vor dem Vergessen bewahrt hat: Im 20. Jahrhundert hatte sich dieses Inselvolk vom Meer abgewandt. In Manama beispielsweise organisiert das Kulturzentrum Dar Al Muharraq Workshops, in denen ehemalige Taucher Oberschülern von ihrem Leben auf See berichten. Vielleicht werden dadurch Berufe geweckt.
In der Kunst inspiriert die Perle eine neue Generation von Designern: Perlmuttskulpturen, zeitgenössische Installationen, schlichter Schmuck und Gedichte, die die Schönheit des Meeres besingen, tauchen wieder auf. Sogar Architekten lassen sich von der Perle inspirieren: In Diyar Al Muharraq, einer neuen Stadt am Meer, erinnern einige Gebäude in ihrer Form an halb geöffnete Austern, während die Straßen mit Mosaiken geschmückt sind, die alte Seewege darstellen. Die Perle wird auch zu einem diplomatischen Objekt: Sie wird Staatsoberhäuptern geschenkt oder auf internationalen Messen ausgestellt und erzählt von einem Bahrain, das tief in seiner Geschichte verwurzelt ist und den Klischees über die Region widerspricht. Für viele Bahrainer sind die Erinnerungen an das Meer im Familiengedächtnis verankert: Die Großväter waren Taucher oder Kapitäne, die Großmütter verkauften Muscheln oder bestickten die Kleidung der Seeleute. Und es ist wohl kein Zufall, dass die Demonstranten des Arabischen Frühlings ihr Hauptquartier auf dem Perlenplatz in Manama aufgeschlagen haben.
Heute übernimmt eine neue Generation von Fischern das Ruder. Auch wenn die Taucher nun mit Flaschen ausgerüstet sind und nicht mehr ihr Leben bei immer mehr Schnorchelgängen riskieren, sind die Perlen Bahrains immer noch so schön wie vor 5.000 Jahren.